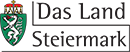Wolf (canis lupus)
Der Wolf (Canis lupus)
Mitteleuropäische Wölfe wiegen durchschnittlich 30 bis 50 kg. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und haben einen optimalen Geruchssinn. Sie werden durchschnittlich 5 bis 7 Jahre alt und erreichen in freier Wildbahn ein Höchstalter von 10 bis 13 Jahren.
Wölfe leben in einem stark ausgeprägten Sozialverband (Rudel) und leben in Familien mit starken Bindungen und Hierarchien. Sie kommunizieren untereinander durch Heulen. Wenn die Jungtiere das Elternrudel verlassen, wandern sie viele hunderte Kilometer alleine - sie sind in dieser Phase also Einzelgänger, bis sie einen Partner gefunden haben. Pro Tag können sie bis zu 100 km zurücklegen. Jungwölfe werden mit 10 bis 22 Monaten geschlechtsreif und wandern aus ihrem Rudel ab.
Wölfe sind sehr anpassungsfähig und daher fähig, in klimatisch unterschiedlichsten Regionen zu überleben, von arktischen Gebieten bis hin zu Wüstenlandschaften. Die Art von Vegetation spielt als solches kaum eine Rolle, nur das Vorkommen von wilden Huftieren als bevorzugte Nahrungsgrundlage ist ein entscheidender Faktor. Die Reviergröße wird vor allem über das Nahrungsangebot bestimmt und liegt in etwa zwischen 150 und 350 km2.
Verbreitung
Der Wolf kam einst fast flächendeckend in der gesamten nördlichen Hemisphäre vor. Vor etwa 120 Jahren wurde er so stark bejagt, dass er als beinahe ausgestorben galt. In Europa konnten nur wenige Wolfspopulationen in den Oststaaten, Griechenland, dem Balkan, Italien und der Iberischen Halbinsel überleben. Durch den europaweiten Schutz und das Verbot der Bejagung konnte sich der Wolf langsam wieder ausbreiten.
Die Ergebnisse des genetischen Monitorings im Zuge der Rissbegutachtungen seit 2018 zeigen für die Steiermark ein Vorkommen von Wölfen überwiegend aus der italienischen und der dinarisch-balkanischen Teilpopulation, vereinzelt auch aus der nördlichen Teilpopulation.
Die Teilpopulationen, die die Steiermark besiedeln, sind aktuell in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet in Ausbreitung begriffen und der vorhandene, bereits besiedelte und noch unbesiedelte Lebensraum lässt eine langfristige Etablierung der Art zu.
Die Ausbreitungsdynamik dieser Tierart lässt darauf schließen, dass der Wolf in Österreich wieder dauerhaft ansässig sein wird. Die bisherigen Monitoringdaten belegen einen eindeutig positiven Trend der Bestandsentwicklung in Richtung günstigen Erhaltungszustand.
Jagdverhalten
Wölfe sind Rudeltiere und jagen vor allem größere Beutetiere im Familienverband. Die Nahrung wird auch gemeinsam verspeist.
Der Wolf ist ein Fleisch- und Aasfresser und jagt bevorzugt Huftiere. Dazu zählt Schalenwild wie Rehe, Wildschweine und Hirsche. Er verschmäht auch kleinere Beutetiere wie Mäuse, Hasen oder Füchse nicht. Gelegentlich fressen Wölfe auch Früchte, Insekten und Reptilien. In der Natur kann es vorkommen, dass der Hetzjäger wochenlang keine Beute fängt, daher wird jede Möglichkeit Beute zu machen wahrgenommen. Als Nahrungsopportunist erbeutet er bei Gelegenheit, deshalb auch Nutztiere. Fliehendes Vieh löst beim Wolf den Hetz-Instinkt aus, wodurch es vorkommt, dass mehr Tiere gerissen als genutzt werden können.
Ein erwachsener Wolf benötigt durchschnittlich zwei bis drei Kilogramm Fleisch pro Tag, wobei er sowohl wochenlang fasten als auch nach einer erfolgreichen Jagd zehn Kilogramm auf einmal fressen kann. Kleinere Beutetiere wie Hasen oder Frischlinge werden meistens im Ganzen verzehrt. Von einem erbeuteten Rothirsch bleiben durchaus Teile übrig, von denen wiederum Rabenvögel, Füchse, Marder oder Wildschweine profitieren.
Verhalten bei Wolfssichtungen
In der Regel geht von wildlebenden Wölfen keine Gefahr für Menschen aus, da der Mensch weder als Beutetier noch als Artgenosse wahrgenommen wird. Wölfe verhalten sich dem Menschen gegenüber von Natur aus vorsichtig und meiden die direkte Begegnung. Meistens weichen Wölfe dem Menschen aus, noch ehe diese vom Menschen bemerkt werden. Trifft ein Wolf zufällig direkt auf einen Menschen, flüchtet der Wolf sofort oder verharrt kurz und flüchtet dann.
Berichte über Angriffe sind größtenteils auf tollwütige Wölfe zurückzuführen, wobei die Tollwut durch Impfköder in Mitteleuropa als weitgehend ausgerottet gilt. Gefahr geht vom Wolf nach Einschätzungen von Expertinnen und Experten nur in speziellen Umweltsituationen aus - zum Beispiel durch gezieltes Füttern. Statistisch gesehen sind Wolfsübergriffe allerdings sehr selten. So fielen laut einer Studie des Norwegischen Instituts für Naturforschung aus dem Jahr 2002 zwischen 1950 und dem Jahr 2000 in ganz Europa (Vorkommen etwa 15000-20000 Tiere) neun Menschen Wolfsangriffen zum Opfer. Davon waren fünf der Fälle auf Tollwut zurück zu führen. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 59 Übergriffe von denen 38 in Zusammenhang mit Tollwut gestanden sind. Verhalten bei Wolfssichtung
Verhalten bei Wolfssichtung
Monitoring
Das Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs ist damit beauftragt, bundesweit ein opportunistisches Wolfs- und Rissmonitoring durchzuführen. Wolfsnachweise in Österreich
Wolfsnachweise in Österreich
Dieses ständig weiter zu entwickelnde Werkzeug soll dabei helfen, möglichst aktuell über Wolfsbewegungen in Österreich zu informieren. Dadurch soll es potentiell Betroffenen ermöglicht werden, zielgerichtet und zeitnah zu agieren, um in der Lage zu sein, Wolfsübergriffe auf Nutztiere am Betrieb zu verhindern. Wolf-Sichtungen oder Risse können Sie uns gerne hier melden.
Wolf-Sichtungen oder Risse können Sie uns gerne hier melden.
Prävention und Herdenschutz
Die Rückkehr des Wolf stellt eine große Herausforderung für die bestehende Weidetierhaltung dar, die vielerorts angepasst werden muss. Wirksamer Herdenschutz ist fachlich anspruchsvoll. Herdenschutz in alpinen Gebieten ist aufgrund des Geländes und der oft schlechten Zugänglichkeit schwieriger als im Flachland.
Herdenschutzmaßnahmen sind je nach Örtlichkeit unterschiedlich wirksam, ein vollkommene Schutz ist nicht möglich, Schäden können jedoch effektiv verringert werden.
Nicht alle Herdenschutzmaßnahmen können überall umgesetzt werden, je nach lokalen Gegebenheiten ist oft eine Kombination unterschiedlicher Maßnahmen zielführend. In Frage kommen insbesondere Herdenschutzzäune, Behirtung, Herdenschutzhunde und/oder nächtliches Zusammentreiben von frei weidenen Herden (Nachtpferch). Künftig sollen auch in der Steiermark nach Abklärung aller rechtlicher Bestimmungen entsprechend zertifizierte Herdenschutzhunde zum Einsatz kommen können.
Betreffend Herdenschutzmaßnahmen wird auf die Broschüre des Österreichzentrums und die Förderung von Zäunen auf Heimweiden verwiesen.
 Herdenschutz-Broschüre
Herdenschutz-Broschüre Zaunförderung Heimweiden
Zaunförderung Heimweiden
Vorgehen bei Rissen
Seit dem Jahr 2019 werden in der Steiermark Personen aus der Landesverwaltung zu RissbegutachterInnen ausgebildet. Ihre Aufgabe besteht in der Dokumentation gemeldeter Risse, Probennahme für DNA-Analysen und in der Unterstützung Betroffener. Die schnelle und kompetente Reaktion auf Rissmeldungen ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Beurteilung und, wenn Nutztiere betroffen sind, für die effektive Schadensabgeltung.
Das Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs bietet als Soforthilfe für Betroffene außerdem ein Beutegreifer-Notfallteam an, das beim Aufstellen von Herdenschutzzäunen, beim Zusammentreiben versprengter Tiere oder auch bei einem vorzeitigen Abtrieb unterstützt.
Sollte es zu einem Übergriff auf Nutztiere kommen, stehen in jedem steirischen Bezirk RissbegutachterInnen zur Verfügung. Die Aufgabe dieser amtlichen, unabhängigen ExpertInnen ist es, festzustellen, ob ein Wolfsriss vorliegt. In weiterer Folge unterstützen diese Sachverständigen auch bei der Abwicklung des Schadensfalles und der Einreichung der Unterlagen bei der Versicherung. In der Steiermark wurden die Entschädigungszahlungen dem jeweiligen Verwertungs- beziehungsweise Zuchtwert der Nutztiere angepasst.
Die RissbegutachterInnen erheben mittels wissenschaftlich eindeutiger Methoden, wie Spuren- und Rissbildanalyse, Spurensicherung sowie Laboranalytik, ob tatsächlich ein Wolfsriss vorliegt, denn nur dann erfolgt eine Schadensabgeltung.
 Die Liste der RissbegutachterInnen in Ihrem Bezirk finden sie hier
Die Liste der RissbegutachterInnen in Ihrem Bezirk finden sie hier
Wolfsverordnung
Der Wolf gehört auf europäischer Ebene zu den streng geschützten Tierarten. Der hohe Schutzstatus ist sowohl ist in Anhang II der Berner Konvention als auch in der sg. Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL der EU) in den Anhängen II und IV geregelt. Im Landesrecht wird der Schutz des Wolfes in § 17 Steiermärkisches Naturschutzgesetz 2017 geregelt. Der Wolf ist Wild gemäß § 2 Steiermärkisches Jagdgesetz 1986 und ganzjährig geschont.
Ausnahmen vom strengen Schutz (z.B. Verbot des absichtlichen Fangens, der Störung oder Erlegung von Wölfen) können von der Steiermärkischen Landesregierung selektiv und unter streng überwachten Bedingungen zugelassen werden.
Am 07.12.2023 wurde von der Steiermärkischen Landesregierung eine „Wolfsverordnung" beschlossen. Die Verordnung soll die mit dem Ansteigen der Wolfspopulation verbundenen Konflikte entschärfen und die Koexistenz zwischen Wolf und Mensch fördern.
Wenn es sich bei einem Wolf um einen Risikowolf oder Schadwolf handelt, darf dieser nach sachverständiger Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen (z.B. vorherige Vergrämung) erlegt werden. Die sachverständige Prüfung erfolgt durch eine Amtssachverständige für Naturschutz und einen Amtssachverständigen für Wildökologie.
Die Erlegung darf ausschließlich durch Jagdausübungsberechtigte oder von diesen beauftragte Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen Jagdkarte sowie Jagdschutzorgane mit einer nach dem Steiermärkischen Jagdgesetz 1986 für die Jagd auf Wild bestimmten Schusswaffe, Munition und Zubehör erfolgen
| Amtssachverständige Wolfsverordnung | |
| Abteilung 10 | Abteilung 13 |
| Klaus TIEFNIG, DI Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft Ragnitzstraße 193 8047 Graz Tel.: 0316 877 4530 Mobil: 0676 8666 4530 klaus.tiefnig@stmk.gv.at |
Andrea BUND, Maga. Baubezirksleitung Südweststeiermark Marburgerstraße 75 8435 Wagna Tel.: 03452 82097 653 Mobil: 0676 866 43 653 andrea.bund@stmk.gv.at |
Risikowolf
Wölfe verhalten sich dem Menschen gegenüber grundsätzlich von Natur aus vorsichtig und meiden die direkte Begegnung. Meistens weichen Wölfe dem Menschen aus, noch ehe diese vom Menschen bemerkt werden. Trifft ein Wolf zufällig direkt auf einen Menschen, flüchtet der Wolf sofort oder verharrt kurz und flüchtet dann.
Ein Risikowolf zeigt gefährliches Verhalten und verhält sich unprovoziert aggressiv (z.B. Drohgebärden wie hochgezogenen Lefzen, aufgestellte Rückenhaare, starre Körperhaltung, Knurren oder Zähnefletschen).
Schadwolf
Das Verletzen und/oder Töten von nicht oder nicht sachgerecht geschützten Nutztieren wird grundsätzlich als natürliches Verhalten angesehen.
Ein Schadwolf zeigt untragbares Verhalten indem er sachgerechten Herdenschutz überwindet, wobei hier nicht die Anzahl nachweislich verletzter und/oder getöteter Nutztiere, sondern die Häufigkeit des Überwindens von Herdenschutz ausschlaggebend ist. Schutzzäune müssen zum Zeitpunkt des Überwindens durch einen Wolf funktionsfähig sein. Wolfsverordnung
Wolfsverordnung Risikowolf Anlage 1
Risikowolf Anlage 1 Schadwolf Anlage 2
Schadwolf Anlage 2 Erläuternde Bemerkungen zur Wolfsverordnung
Erläuternde Bemerkungen zur Wolfsverordnung Meldungen und Maßnahmen
Meldungen und Maßnahmen Wolfsmanagement Steiermark
Wolfsmanagement Steiermark
 Managementplan Österreich
Managementplan Österreich